Er zählt zu den Pionieren des Digitalzeitalters. Er will den Tod abschaffen. Und er ist überzeugt: Die globale Wirtschaft stagniert seit Jahrzehnten.
Im grossen Gespräch erklärt Peter Thiel, warum Donald Trump „viel zu wenig disruptiv“ handelt.
Herr Thiel, wir treffen uns hier in Los Angeles – und nicht in Palo Alto, wo Sie jahrelang tätig waren. Sie haben das Silicon Valley verlassen. Läuft etwas falsch mit dem Hotspot der Tech-Industrie?
Es gibt da längst viel zu viel Bequemlichkeit und Konformismus. Schauen Sie: 2005 hielt ich in Stanford, mitten im Silicon Valley, eine Rede, und die Frage war – wo entsteht gerade das nächste Google? Die Antwort, die ich damals gab, war ziemlich optimistisch: Mit einer 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit befindet sich das nächste Google in einem Umkreis von acht Kilometern. Wir finden es nicht in der Suchmaschine, nein, wir finden es hier, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Stanford. Und rückblickend sollte ich recht behalten: Das nächste Google hiess Facebook, und es befand sich sogar bloss drei Kilometer von jenem Raum entfernt, in dem ich 2005 gesprochen hatte. Heute würde ich sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Google überhaupt noch irgendwo im Silicon Valley anzutreffen ist, beträgt deutlich weniger als 50 Prozent.
Warum? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
Nun, das Valley verfügte jahrelang über einzigartige Vorteile: Es gab die Netzwerk-Effekte an allen Ecken und Enden. Es gab diese hohe intellektuelle Intensität und Vielfalt. Es gab gute Leute, die nur darauf warteten, loszulegen, Unternehmer, Investoren, Innovatoren. Und es gab diese unglaubliche Geschwindigkeit, vor allem was konsumentenorientierte Internet-Firmen angeht. Die Situation hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Gute Leute können mit ihren Firmen irgendwo in den USA starten, und sie bekommen auch das nötige Geld, wenn sie eine überzeugende Business-Idee präsentieren. Zweitens – die positiven Netzwerk-Effekte im Silicon Valley haben sich in ihr Gegenteil verkehrt, ja geradezu pervertiert.
Das ist ein starkes Wort. Fühlen Sie sich verstossen?
Verstossen – warum? Ich bin ein Venture Capitalist – schwinden die Geschäftsmöglichkeiten, schwindet auch mein Interesse, denn irgendwann wird es auch intellektuell dürftig. Schauen Sie: Die Weisheit der vielen hat sich in die Dummheit der vielen, ja in eine Art Massenwahn verwandelt. Der intellektuelle, aber auch der politische Konformismus im Silicon Valley ist zum Schreien. Um es klipp und klar festzuhalten – ich muss es auf Deutsch sagen: Die Köpfe haben sich gleichgeschaltet. Der eine sagt, was der andere sagt, um ja nicht anzuecken. Auch im Business-Bereich spielt längst dieselbe Dynamik.
Woran machen Sie dies fest?
Silicon Valley ist mittlerweile mehr Mode als Gelegenheit. Wenn der eine tut, was der andere tut, und der eine kaufen will, was der andere gerade gekauft hat, wenn also diese Art der Goldgräberstimmung herrscht, dann wissen Sie, dass die beste Zeit eines Orts vorbei ist. Alle diese Phänomene wurden im Silicon Valley in den letzten fünf Jahren sichtbar. Nicht mehr in erster Linie die guten, sondern die gierigen Leute kommen. Und die Leute, die da leben, haben längst begriffen, dass etwas nicht stimmt.
Wie das?
Es gibt dafür einen einfachen Indikator: Wenn eine Einzimmerwohnung 4000 Dollar Miete kostet, dann ist etwas faul im Staate. Dann wird kreative Arbeit zu teuer, dann kannst du Dinge, die Zeit brauchen, nicht mehr durchziehen. Im Vordergrund steht dann der schnelle Profit. Und es dominieren die grossen Firmen mit Preissetzungsmacht, die sich solche Verhältnisse leisten können.
Achtung, Blase!
Trotzdem, geben Sie es zu: Sie vermissen hier in Los Angeles die Intensität des Silicon Valley . . .
. . . ein kleines Team braucht Intensität, um erfolgreich zu sein. Und so ticke ich, stimmt. Anderseits hat Intensität auch eine problematische Seite – dann nämlich, wenn es um die Intensität des grossen Wettbewerbs geht. Erstere ist gesund und spornt dich an, Letztere ist ungesund und macht dich auf die Dauer kaputt. Silicon Valley erinnert mich heute an Manhattan, Stanford immer mehr an Harvard. Du hast allenfalls Dichtestress, aber keinen produktiven Stress mehr.
Es ist ja nicht gesagt, dass der nächste Internet-Gigant überhaupt aus den USA kommt. Womöglich entsteht er gerade in China. Haben Sie den Osten im Auge?
Natürlich, ich will verstehen, was dort läuft. China ist in der Digitalwirtschaft ein Hotspot. Persönlich hoffe ich, dass das Land nicht zu mächtig wird. Und ich sehe, wie schwierig es ist, als Outsider wirklich teilzunehmen. Die Chinesen lassen Investoren wie mich, die kein eingetragenes Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas sind und wohl auch nicht gerade über den besten Ruf verfügen, aussen vor. Aber Sie brauchen nicht so weit in die Ferne zu schweifen, auch in Europa tut sich was, allerdings eher im Osten als im Westen.
Sie haben in einige Startups in Berlin Geld investiert . . .
Nicht nur. Wir haben uns mit unseren Fonds erfolgreich bei Spotify in Schweden engagiert, dem Musikstreamingdienst, bei Deepmind in London, das auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist und mittlerweile von Google gekauft wurde, bei Transferwise ebenfalls in London, einem führenden Fintech-Anbieter, und dann, ja, bei N26 in Berlin, einer Direktbank, die über das Smartphone bedienbar ist. Ich bin heute weniger optimistisch, was Berlin angeht, als noch vor ein paar Jahren. Die deutsche Hauptstadt zeigt auch schon Symptome von Trägheit. Berlin muss sich ernsthaft fragen – will es ein Ort sein, wohin junge, ambitionierte Leute gehen, um etwas zu bewegen, oder will es ein Ort sein, wohin junge Leute ziehen, um bereits in frühen Jahren in Rente zu gehen? Beides geht nicht.
KI meint alles und – darum, dialektisch gedacht – zugleich nichts.
Wie sehen Sie die Startup-Szene der Schweiz? Da bewegt sich in der Tat einiges, mitunter in Zürich, dank ETH-Abgängern.
Die Schweiz scheint mir interessanter für das, was ich Hardtech nenne – also Business ausserhalb der reinen Internet-Dienstleistungen, vor allem im Biotech-Bereich. Es braucht oftmals mehr Kapital und Einsatz, um diese Ideen zum Fliegen zu bringen. Sie brauchen Leute, die in Wissenschaft und Umsetzung, in Kreation und Business herausragend sind. Mir scheint, die Schweiz sei Pflaster, das einen zweiten Blick verdient – gerade für diese Kombination.
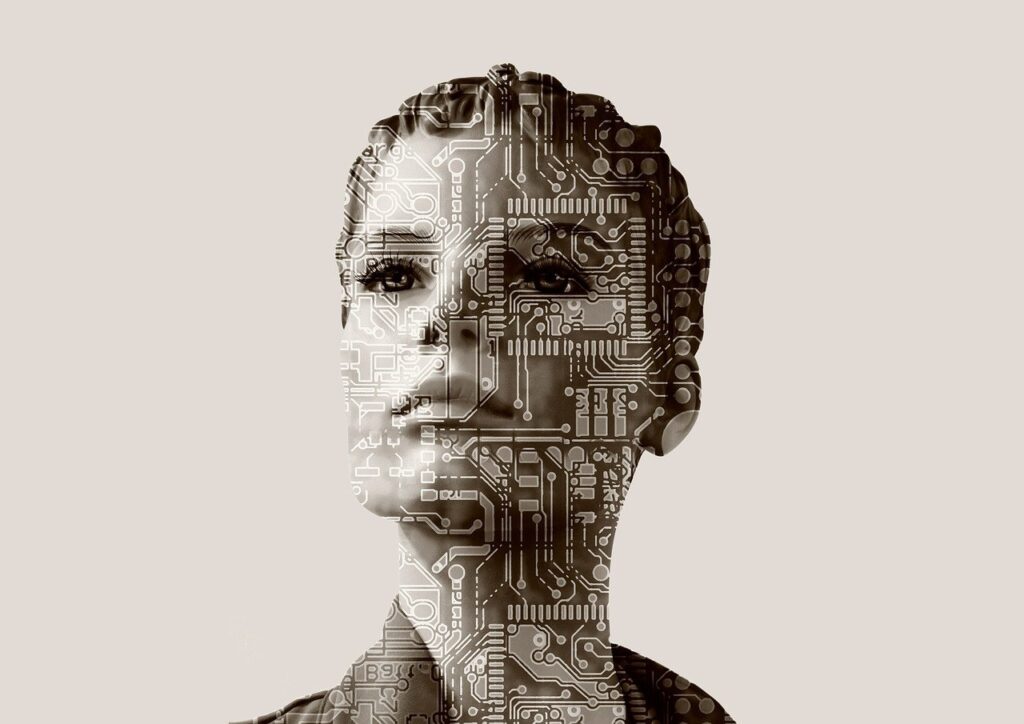
Künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, selbstfahrende Autos, Besiedelung des Alls. Wo erwarten Sie den nächsten Durchbruch?
Ganz ehrlich: Das ist mir zu abstrakt, zu sehr Geschwafel. Die PR-Maschinerie des Valley bringt solche Wortkreationen in Umlauf, aber was bedeuten sie am Ende des Tages konkret? Die grössten Vorbehalte hege ich gegenüber dem Ausdruck der künstlichen Intelligenz. Ist damit die letzte Generation von Computern gemeint oder die nächste, assoziieren wir damit den Kampf Mensch gegen Maschine wie im «Terminator»-Film von 1984, sprechen wir vom Überwachungsstaat Chinas oder von einer Zukunft à la Ray Kurzweil, in der Mensch-Maschinen-Cyborgs den nächsten Schritt der kulturellen Evolution darstellen? KI meint alles und – darum, dialektisch gedacht – zugleich nichts.
Welches sind denn die nächsten Herausforderungen des menschlichen Lebens, für die die Technologie neue Lösungen zu bieten hat?
Wir stehen an einem Wendepunkt. Ein Vierteljahrhundert lang ging es einzig um Internet-Dienstleistungen für Konsumenten, man könnte auch sagen: um die Ökonomie digitaler Plattformen. Sie sollten das Leben erleichtern. Alle heute existierenden Giganten fallen unter diese Kategorie: Amazon, Facebook, Google, Uber, Airbnb. Der Wert beträgt je nachdem mehrere 100 Milliarden Dollar. Die grösste Firma, die nicht bloss auf Software beruht, ist womöglich Tesla von Elon Musk. Ihr Wert dürfte sich auf 40, maximal 50 Milliarden belaufen. Die besten und erfolgreichsten Biotech-Unternehmungen sind derweil 10, vielleicht 20 Milliarden wert. Kurzum, Software war bisher das einzige Spiel, in dem richtig die Post abging.
Also ist die Zeit der Software vorbei, und die Zeit der digital aufgerüsteten Hardware kommt?
Das ist die grosse Frage. Neue Internet-Dienstleistungen sind in kürzester Zeit wie Pilze aus dem Boden geschossen, und sie waren nur möglich dank dem Smartphone, einer echten Innovation, die allerdings schon über zehn Jahre zurückliegt. Die existierenden Internet-Firmen werden weiter wachsen, keine Frage, aber ich fürchte, die wirklich guten, wirklich disruptiven Ideen sind weitgehend ausgeschöpft. Und was Hardtech angeht, nun, da stehen wir meiner Ansicht nach erst ganz am Anfang.
Kreativ sind die, die den Tod erfolgreich verdrängen.
Stichwort Biotech. In Ihrem Manifest von 2009 erwähnen Sie die Überwindung des Todes als eine der zentralen Forderungen einer ernstzunehmenden libertären Philosophie. Die klassische Philosophie würde demgegenüber die Sterblichkeit bzw. Endlichkeit des Menschen als Quelle seiner Innovationskraft betonen, an der Ihnen so viel gelegen ist. Wie gelangen Sie zu Ihrem Standpunkt?
Die Frage nach den Anreizen ist immer knifflig. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit dem Bruder meiner Grossmutter in Deutschland. Mein Grossonkel war ein sehr kluger Typ, intellektuell breit aufgestellt, und hatte in guter Position in einer Bank gearbeitet. Er war damals 80 und sagte mir: «Schau, ich hätte seit meiner Pensionierung vier Doktorhüte bekommen können, aber ich hab’s nicht gepackt, weil ich nicht wirklich daran glaubte, dass ich so alt werden würde.» Diese Worte haben lange in meinem Kopf nachgehallt, und sie sind das perfekte Gegenbeispiel zum Räsonnement der klassischen Philosophie.
Inwiefern genau – weil der Spass am Leben die beste Motivation ist?
Nun, die guten Leute werden nicht durch morbide Gedanken oder die Existenzangst nach Martin Heidegger motiviert. Sie tun etwas vielmehr darum, weil sie es tun wollen, und die Perspektive, ein ganzes – unendliches – Leben alles Mögliche tun zu können, spornt sie umso mehr an. Umgekehrt haben die, die sich vor dem Tod ängstigen, nicht unbedingt einen besseren Zugang zur Wirklichkeit oder mehr Biss. Denn Angst hemmt. Ich denke, Menschen, die von Existenzangst besessen sind, sind am Ende viel weniger produktiv. Kreativ sind die, die den Tod erfolgreich verdrängen.
Haben Sie selbst denn Angst vor dem Tod?
Ganz ehrlich: Er interessiert mich erst mal nicht. Stoiker zum Beispiel sind besessen vom Tode. Ich bin jedoch das Gegenteil eines Stoikers, ich verabscheue die Ruhe und habe auch nicht im Sinne, auf dem Land zu leben und über die Umgebung zu meditieren. Und ich bin ebenso wenig ein Epikureer, der angesichts des Todes folgert, dass er am besten jeden Augenblick geniesst, weil das Ende ihn stets ereilen kann. Bullshit! In Firmen, die stoisch oder epikureisch ticken, würde ich, ehrlich gesagt, keinen Cent investieren. Ich will diese zufällige, verrückte Welt nicht einfach annehmen, weil ich sowieso nichts ändern kann. Nein, ich will sie verändern, ich will sie gestalten, und ich habe verdammt viel Spass daran. Die Überwindung des Todes ist doch nicht der Untergang des Abendlandes!
Sie sprechen einen Mentalitätsunterschied zwischen Europäern und Amerikanern an. Allerdings wollen auch nicht alle Amerikaner gleich den Tod abschaffen. Was also bewegt Sie? Und wie wollen Sie das bewerkstelligen?
In der frühen Moderne, im 17. und 18. Jahrhundert, zählte die radikale Lebensverlängerung zu den grossen Aufgaben des wissenschaftlichen Projektes. Denken Sie nur an Francis Bacon oder, später, an Benjamin Franklin in den USA. Den Optimismus dieser grossen Menschen haben wir irgendwo zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert verloren. Die Frage, warum Menschen überhaupt altern, ist viel zu wenig erforscht. Wir wissen es letztlich nicht. Es gibt einige biologische Theorien, aber bis heute keine letztgültige. Die Stammzellen sterben nicht, sondern reproduzieren sich, aber wir, deren Träger, sterben. Das ist einerseits schockierend und anderseits hochspannend. Die meisten Krankheiten, die wir haben, sind auf die eine oder andere Art mit dem Alter verknüpft, und umgekehrt lässt sich das Altern selbst als eine Art Krankheit betrachten. Krankheiten lassen sich heilen. Ist das Altern wirklich irreversibel, oder denken wir das bloss? Warum also, einfach gesagt, sollten wir nicht auch vom Tod geheilt werden können?
Im Netz gab es eben irgendwann ein Übergewicht konservativer Ansichten, die sich gegen den linksliberalen Mainstream richteten. Nur so sind der Brexit und der Aufstieg Donald Trumps erklärbar.
Sie haben Philosophie studiert. Und ich weiss, dass Sie Leo Strauss, den deutsch-amerikanischen Professor für politische Philosophie, mögen. Strauss sagte einmal ganz bescheiden: «Wir selbst sind nicht weise, sondern wünschen, weise zu werden, wir sind Weisheitssuchende, philo-sophoi.» Ist das auf Ihrer Linie?
Mit diesem Zitat habe ich meine Mühe. Die Frage, die sich mir sogleich stellt, ist die folgende – warum soll ich nach Weisheit streben, wenn ich sie letztlich nie bekomme? Strauss denkt hier noch sehr europäisch, als wäre die endlose Suche nach Weisheit oder Wahrheit ein Wert an sich. Das sehe ich diametral anders. Wir sollten nach ihr suchen – und sie dann auch finden und etwas mit ihr anstellen, was uns weiterbringt.

Was das Internet angeht, so hält sich die Weisheit jedoch bis jetzt in engen Grenzen. Das Netz war ja einmal das Versprechen der grossen Freiheit – daran gekoppelt war auch die Vorstellung eines Raums des ungezwungenen Austauschs, nach dem Motto: Du kannst sagen, was immer du denkst. Von diesem Versprechen entfernen wir uns immer weiter.
Stimmt – das war die 1990er-Jahre-Version des Internets: eine Zukunft der Privatheit und Anonymität, also der Verschlüsselung und Intransparenz. Die heutige Version hat damit nicht mehr viel zu tun. Das Internet wird immer transparenter, also öffentlicher, und dadurch weniger privat. Es findet geradezu eine Politisierung des Netzes statt.
Waren es einst Staaten, die Zensur übten, sind es heute private Akteure wie Facebook oder Google. Ist das wirklich eine Verbesserung der Lage – oder sogar eine Verschlimmerung, weil keine demokratische Kontrolle – wie rudimentär auch immer – möglich ist?
Nein. Staatliche Zensur ist immer schlimmer als private, aus dem einfachen Grund, weil der Staat immer der mächtigste Akteur ist. Aber ich denke sowieso, wir müssen hier wiederum präzise sein und ein paar Dinge unterscheiden.
Was denn?
Auf der einen Seiten haben wir den Problemknäuel Zensur/Meinungsäusserungsfreiheit. Auf der anderen haben wir den Knäuel Privatheit/Transparenz, und als Drittes kommt noch die Antitrust/Monopol-Frage. Die Frage nach Zensur war vor 20 Jahren absolut kein Thema – ganz im Gegenteil: Das Internet war ein grosses progressives Freiheitsversprechen. Die Hoffnung war, dass alle zu progressiven Zeitgenossen würden, die ihre fast identischen Ansichten und Positionen manierlich untereinander austauschten. Aber das Internet brachte nicht die grosse Harmonie auf Erden, sondern funktionierte eher wie eine Fortsetzung des Gutenberg-Projekts. All jene, deren Haltungen und Ansichten in den etablierten Medien unterdrückt wurden oder jedenfalls nicht vorkamen, verschafften sich nun plötzlich Gehör; es war nicht für, sondern gegen das Establishment. Nach der Erfindung des Buchdrucks wimmelte es plötzlich von protestantischen Schriften, die gegen die katholische Orthodoxie anschrieben, und im Netz gab es eben irgendwann ein Übergewicht konservativer Ansichten, die sich gegen den linksliberalen Mainstream richteten. Nur so sind der Brexit und der Aufstieg Donald Trumps erklärbar.
Wir wollen keinen Social-Credit-Score wie in China. Wir wollen uns nicht nackt ausziehen. Es gibt ein Leben nach Google.
Und die Privatheit – gehört sie aufgrund der technologischen Entwicklung de facto der Vergangenheit an? Mir scheint, die meisten User hätten längst resigniert: Wir geben ja seit Jahr und Tag die persönlichen Daten über uns preis – für ein Butterbrot.
Hm. Schwierige Frage. Ich fürchte, ich muss ausholen.
Tun Sie’s.
Wären wir im Jahre 1968 und würden miteinander plaudern, so hätten alle Experten gesagt: Die digitale Technologie befördert die Zentralisierung. Der Fluchtpunkt aller Vorstellungen war damals der allwissende gottähnliche Computer, der sämtliche Daten besitzt und verarbeitet – denken Sie nur an «HAL», den Supercomputer in Stanley Kubricks «Space Odyssey».
Dreissig Jahre später, 1999, präsentierte sich die Computer-Welt in neuem Licht: Die meisten träumten von einer total dezentralen Welt mit extrem vielen PC, die libertären und kryptoanarchistischen Phantasien kannten keine Grenzen.
Der Weltstaat war vorbei, nun war das Individuum die Messeinheit. Doch dann änderte sich die Szenerie wieder. Wiederum zwanzig Jahre später, also heute, nähern wir uns unversehens wieder den Vorstellungen von 1969 an:
Es werden gemäss der Meinung der meisten die Staaten oder monopolartige Firmen sein, die Big Data kontrollieren und neue Superrechner entwickeln.
Die grosse Sorge ist nun plötzlich, dass die Regierung – in Zusammenarbeit mit den grossen Tech-Giganten – mehr über dich weiss, als du selbst über dich weisst.
Alle fürchten sich vor der neuen grossen Entmündigung, es dominiert die Angst vor einem neuen totalitären Regime.
Die grosse Frage ist – sind es bloss Ängste, oder sind es realistische Vorstellungen dessen, was auf uns zukommt?
Ich bin kein Hellseher.
Was ich sagen kann, ist dies: Auch die technologische Geschichte verläuft nicht linear, sondern eher in Pendelbewegung.
Deshalb gehe ich davon aus, dass der totalitäre, technologisch aufgerüstete Überwachungsstaat nicht der Endzustand ist.
Wir wollen keinen Social-Credit-Score wie in China. Wir wollen uns nicht nackt ausziehen. Es gibt ein Leben nach Google.Das Pendel schlägt zurück.
Die Privatheit ist nicht vorbei, sie wird als hoher Wert wiederentdeckt werden, weil die Leute dieses Bedürfnis haben und die Politik es aufnimmt – und es wird technische Lösungen geben, um sie im digitalen Zeitalter zu schützen, siehe Blockchain-Technologie.
Und wie beurteilen Sie die Gefahr einer Monopolisierung von Daten und Dienstleistungen im digitalen Zeitalter? Sie sitzen ja selbst im Verwaltungsrat von Facebook, einem der grossen Tech-Giganten.
Wer als digitale Plattform Erfolg haben will, muss eine monopolähnliche Stellung anstreben, das ist völlig klar. Sonst reiben Sie sich im Konkurrenzkampf auf. Aber die Politik zieht nach und beginnt zu regulieren, zunächst in Europa, irgendwann auch in den USA.
Als Libertärer habe ich ein noch grösseres Problem mit Regulierung als mit Monopolen, die spontan auf dem Markt entstehen, aber ich denke, wir stecken hier in einem Lernprozess. Es braucht die Regulierung so lange nicht, wie die Kunden zufrieden sind mit der Dienstleistung, ihre Privatheit geschützt sehen, mit dem Deal einverstanden sind. Das Problem ist, dass die Akteure des Silicon Valley hier zu wenig Benefit für die Leute generieren. Die negativen Punkte überwiegen zurzeit ganz klar. Denn entweder die Firmen stellen ihre Kunden zufrieden, oder die Politik wird Regeln mit Zwang durchsetzen, die kundenfreundlich sein sollen, es am Ende aber erfahrungsgemäss kaum sind.

Nun gut, es liesse sich viel grundlegender einwenden: Inwiefern tragen die Internet-Plattformen überhaupt wesentlich zur Verbesserung der Lage von Otto Normalverbraucher bei? Taxifahrten oder Übernachtungen werden zwar billiger, dafür verliert der Kunde immer mehr Zeit am PC . . .
Sie werden sich vielleicht wundern, aber ich stimme Ihnen absolut zu.
Die neuen digitalen Gadgets täuschen uns darüber hinweg, dass wir letztlich an Ort treten.
Sie bestreiten die Innovationskraft der Internet-Firmen?
Schauen Sie: Kaum überqueren Sie die Brücke nach Oakland, befinden Sie sich in einer Gegend, in der vom technologischen Boom des Silicon Valley nichts zu spüren ist. Die Strassen sind schlecht, die Orte sehen heruntergekommen aus. Nehmen Sie zudem die Produktivitätsraten in den USA – sie sind über die letzten Jahre konstant bescheiden geblieben. Der Ökonom Tyler Cowen brachte diesen Befund bereits 2011 auf den Punkt: Wir erleben im Westen seit längerem eine grosse Stagnation, weil die Innovationsraten laufend fallen. Wir haben das Gefühl, dass wir ständig produktiver und effizienter werden, aber die neuen digitalen Gadgets täuschen uns darüber hinweg, dass wir letztlich an Ort treten. Und ich denke, Cowen kommt der Wahrheit näher als Kurzweil, der davon überzeugt ist, dass wir gleich abheben und Maschinen uns alle Wünsche erfüllen würden.
Damit outen Sie sich fast schon als Technokritiker.
Ich denke, ich sage nur, was Otto Normalverbraucher schon lange weiss. Lassen Sie mich eine kurze Anekdote erzählen. Ich hatte 2012 ein öffentliches Streitgespräch mit Eric Schmidt, dem CEO von Google, in Aspen, Colorado. Er erzählte, wie toll alles sei, wie sehr die Technologie unser aller Leben verbessere. Ich nannte ihn damals Googles Propagandaminister. Damals war ich womöglich noch ein Aussenseiter mit meiner Sicht. Aber wer glaubt heute noch im Ernst, dass die selbstfahrenden Autos gleich um die Ecke sind? Das sind sie nämlich schon seit zehn Jahren, und noch immer warten wir auf sie. Fakt ist aber, dass vielen Leuten am Ende des Monats kaum Geld bleibt, obwohl sie sparsam damit umgehen und einen vernünftigen Job haben – und dann fragen sie sich zu Recht: Wie kann das sein, dass ich, der ich besser ausgebildet bin als meine Eltern, in diesem angeblichen Paradies, in dem alles besser wird, täglich im Hamsterrad strample, ohne Aussicht auf eine nachhaltige Verbesserung meiner Lage?
Sie wollten damals zusammen mit Garry Kasparow ein Buch über den technologischen Stillstand schreiben, es sollte den Titel «The Blueprint» tragen. Warum haben Sie es nicht geschrieben, wenn die These doch an Ihnen nagt?
Wir begannen daran zu arbeiten, aber wir merkten irgendwann: Es ist unendlich schwierig, die Stagnation zu messen. Das ist ein echtes philosophisches Problem.
Ein Merkmal der Spätmoderne besteht in der unaufhaltsamen Arbeitsteilung und Spezialisierung. Sie haben immer kleinere Gruppen von sich selbst kontrollierenden Experten. Nur die wissen genau, was sie tun, nur sie können es beschreiben und messen. Hier eine gemeinsame, für alle Bereiche gültige, genaue Masseinheit zu finden, um technologische Innovation bzw. Stagnation quantitativ zu beurteilen, war schlicht unmöglich. Darum gaben wir das Projekt irgendwann auf.
Sie haben ein leicht spekulatives Mass gefunden, das näherungsweise funktioniert wie mir scheint: das Bauchgefühl von Otto Normalverbraucher.
Ich vertraue dem Common Sense in dieser Frage mehr als der Meinung der Experten. Wenn Sie 100 Leute fragen, ob es ihre Kinder dereinst besser haben als sie, werden 80 antworten: nein, nie im Leben.
Und dann wissen Sie, dass etwas nicht stimmen kann an den Zahlen. Das sind ja keine blossen Einbildungen, das ist die Erkenntnis aus täglicher, harter Erfahrung. Zahlen hingegen lassen sich frisieren.
Denken Sie nur an den Warenkorb, der für die Berechnung des Verbraucherpreisindexes verwendet wird. Da werden ja nicht nur die reellen Preise von Produkten zu Rate gezogen, sondern eben auch Qualitätsverbesserungen – wenn ein neuer Computer plötzlich schneller ist, über mehr Leistung verfügt und mehr Funktionen erfüllen kann.
Da ist der Willkür der Messung Tür und Tor geöffnet. Und natürlich spielen politische Interessen mit: Je tiefer die Inflation veranschlagt wird, umso besser für die Politik. Was aber am Ende des Tages für die Bürger zählt, ist, ob sie besser essen, ob sie bequemer leben, sich ein schöneres Häuschen kaufen können, intakte Zukunftsaussichten haben. Und wenn Sie diese Fragen nicht mit Ja beantworten können, dafür ein modisches Smartphone haben, das Sie nicht mal bedienen können, nun, dann trauen Sie nun mal keinem Ökonomen, Statistiker oder Politiker mehr über den Weg.
Das Misstrauen unter Bürgern gegenüber den Wirtschaftsführern und Politikern scheint im Westen insgesamt zuzunehmen.
Sehen Sie hier einen ursächlichen Zusammenhang – weil die Leute eben am eigenen Leib erfahren, dass zwischen der Rhetorik einer Welt, die immer besser wird, und der Realität der ökonomischen Stagnation eine Kluft besteht?
Wenn meine These stimmt, dann rühren wir hier an den springenden Punkt. Die Leute hätten gerne Fortschritt, aber sie sehen keinen.
Sie strampeln sich ab, und dennoch bleibt nichts übrig. Das führt einerseits zu Frust, anderseits zu Misstrauen gegenüber denen, die es besser haben.
Ich würde die populistische Revolte, die den ganzen Westen erfasst, hauptursächlich darauf zurückführen. Es geht nicht primär um Anerkennung und Würde, nein, es geht um einfache, reine, harte Ökonomie.
Sie haben Donald Trump in seinem Wahlkampf 2016 offiziell unterstützt. Hand aufs Herz: Sind Sie mit seiner Leistung zufrieden, oder bereuen Sie mittlerweile Ihr Engagement?
Ich unterstütze ihn weiterhin und habe auch nicht im Sinne, dies zu ändern.
Es handelt sich in meinem Fall um einen Package-Deal. Ich bin längst nicht in allem seiner Meinung, aber er benennt Probleme und packt sie an.
Und vor allem:
Er hat die Meinungsvielfalt spürbar geöffnet, also den Range an öffentlich zulässigen politischen Positionen, Meinungen und Haltungen in allen möglichen Fragen. Das ist ganz klar ein Freiheitsfortschritt.

Welche Probleme genau meinen Sie?
Das Überdenken von illegaler Immigration war längst fällig – entweder haben wir Gesetze, die gelten, oder wir müssen die Gesetze anpassen. Aber die eigenen Gesetze zu ignorieren, geht in einem Rechtsstaat nicht. Trump knöpfte sich Handelsbeziehungen mit verschiedenen Ländern vor, was völlig legitim und im Interesse der USA ist. Er kuscht nicht länger vor den Chinesen, sondern hat das Reich der Mitte als technologisch, ökonomisch und politisch gewichtigsten Gegner identifiziert. Er hält die Nato-Staaten an, ihren Beitrag zu leisten und sich nicht einfach auf die USA zu verlassen, die schon alles zahlen und richten werden. Jeder, den ich in Deutschland treffe, sagt mir hinter vorgehaltener Hand: Klar müssen wir mehr für die Nato bezahlen.
Das klingt alles zu gut. Wo gehen Sie denn nicht mit ihm einig?
Ich möchte allgemein antworten: Alles geht zu langsam. Trump möchte das Land wirklich reformieren, und das ist gesund. Doch handelt er für meinen Geschmack noch viel zu wenig disruptiv. Allerdings muss man fairerweise auch sehen, wie viel Widerstand ihm von allen Seiten erwächst.
Von Europa aus gesehen, scheint die Diagnose klar: Trump polarisiert und spaltet das Land in zwei unversöhnliche Lager.
Es ist zu billig, die Politiker für alle Unbill dieser Welt verantwortlich zu machen. Nicht sie sind es, die die Leute gegeneinander aufbringen. Im besten Fall wirken sie als Katalysatoren einer Polarisierung, die bereits im Gang ist. Und diese Polarisierung hat meiner Meinung nach nicht in erster Linie mit dem unterschiedlichen Lifestyle der Bürger zu tun, sondern mit der Ökonomie. Die spaltende Kraft ist die Stagnation. Es gibt viele Amerikaner, die kaum mehr über die Runden kommen. Und sie sehen die anderen, die eine Rente abschöpfen. Erstere sehen ihre Felle davonschwimmen, sie misstrauen den Profiteuren des Systems, sie misstrauen dem Establishment, sie misstrauen der Politik.
Sie reden fast schon wie ein verkappter Marxist . . .
. . . Marx war ein kluger Ökonom. Sein historischer Materialismus war Blödsinn, aber er machte interessante Beobachtungen.
Für ihn gab es die bösen Kapitalisten, die die Produktivkräfte besitzen, und die Proletarier, die bloss ihre Arbeitskraft besitzen.
Nun gut.
Der bemerkenswerte Punkt ist, dass er irgendwo sinngemäss sagte:
Wenn die Zinsen gegen null tendieren, dann ist es Zeit für die kommunistische Revolution. Denn dann haben die Kapitalisten keine Ideen mehr, wie sie ihr Geld produktiv anlegen können.
Und hier rühren wir an eine ganz fundamentale Frage, die uns alle betrifft:
Kann eine Demokratie nach westlichem Vorbild in einer Welt ohne ökonomisches Wachstum auf Dauer überhaupt funktionieren?
Die Faschisten und die Kommunisten waren Jugendbewegungen, und unsere Gesellschaft ist so stark überaltert, dass ich hier nicht die geringste Gefahr erkenne.
Sie meinen – wenn es immer weniger zu verteilen und umzuverteilen gibt, dann nehmen die politischen Konflikte der verschiedenen Anspruchsgruppen mit unterschiedlichen Interessen laufend zu?
Genau. Solange der Kuchen wächst, gibt es mehr für alle, wenn auch für die einen noch mehr als für die anderen.
Wenn der Kuchen nicht mehr wächst, ändern sich die Spielregeln: Was die einen mehr bekommen, erhalten die anderen weniger.
Diese Entwicklung birgt unheimliches Konfliktpotenzial. In den USA hatten wir seit der Amerikanischen Revolution ein ziemlich konstantes Wachstum, also über die letzten 250 Jahre.
Europa hingegen erlebte in den 1930er Jahren schon einmal eine Phase der Stagnation. Die Institutionen kamen unter Druck, die Demokratie hörte irgendwann auf zu existieren, und es kamen faschistische oder kommunistische Regime an die Macht.
Diesen Vergleich hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Sie glauben, dass die USA vor einer autoritären, ja womöglich faschistischen Epoche stehen?
Nein, die Faschisten und die Kommunisten waren Jugendbewegungen, und unsere Gesellschaft ist so stark überaltert, dass ich hier nicht die geringste Gefahr erkenne.
Aber die Alten und die Jungen stehen sich immer unversöhnlicher gegenüber, und die Alten sind in der Mehrzahl.
Der ganze Westen steht ohne Zweifel vor grossen politischen Umwälzungen, wenn die Stagnation länger anhält.
Und der amerikanische Präsident hat genau dies begriffen.
Er arbeitet daran, die Produktivkräfte in den USA neu zu entfesseln, wie es einst Ronald Reagan tat.
Er dereguliert die Wirtschaft, er senkt die Steuern und erhöht zugleich die Staatsverschuldung, um zusätzliches Geld in die Wirtschaft zu pumpen.
Da ist er den meisten europäischen Leadern voraus, die von einer Post-Wachstum-Ökonomie fabulieren und im Ernst glauben, sie könnten die demokratischen Institutionen ohne wirtschaftliches Wachstum erhalten. Vergiss es, das sind Hirngespinste.
Es gibt auch die Hirngespinste derer, die sagen, wir brauchen wieder Krieg, damit wir wieder etwas aufzubauen haben. Das ist eine Ansicht, die immer mehr Leute hinter vorgehaltener Hand vorbringen.
Wer das sagt, dem fehlt es echt an Phantasie – der weiss in seiner Luxussituation nicht, was Krieg an Leid und Zerstörung mit sich bringt.
Und seit 1945, als die erste Atombombe abgeworfen wurde, kann sowieso jeder Krieg eine solche Zerstörungswucht entfalten, dass nur schon der Gedanke daran Angst macht.
Wir haben Waffen, um den ganzen Planeten mehrfach in die Luft zu jagen, verdammt nochmals.

Aber Sie gehen davon aus, dass wir in explosiven, ja vielleicht vorrevolutionären Zeiten leben?
Nicht unbedingt. Natürlich kann die Situation explodieren – anderseits ist es auch möglich, die Leute ruhigzustellen, mit Brot und Spielen, mit Drogen, mit virtueller Realität, mit Streaming, mit was auch immer. Ich bin für die Legalisierung der Drogen, aber diesen Punkt sehe ich kritisch.
Der Anthropologe, der sich jüngst wohl am intensivsten mit dem menschlichen Konfliktpotenzial befasst hat, ist René Girard. Sie haben bei ihm in Stanford studiert. Was haben Sie, mit Blick auf unsere politische Gegenwart, von ihm gelernt?
Der Mensch ist das Tier, das sich ständig mit anderen vergleicht. Seit wir die Ständegesellschaft abgeschafft haben, in der eine natürliche, vertikale Ordnung herrschte, hat sich das Sich-Vergleichen in unerhörter Weise intensiviert. Man könnte durchaus sagen, und wir erleben es ja jeden Tag: je horizontaler die Gesellschaft, desto stärker die Mimesis. Die egalitäre Gesellschaft ist aus Sicht der mimetischen Theorie absolut toxisch. Denn wenn sich jeder mit jedem vergleicht, nimmt die Rivalität zu, folglich auch der Neid und also das gesamtgesellschaftliche Konfliktpotenzial. Zugleich haben wir uns jedoch moralisch weiterentwickelt. Wir leben die Rivalität nicht offen aus, sondern haben Spielregeln definiert, um die Energien zu kanalisieren. Neid und Moral halten sich irgendwie die Waage – denn täten sie es nicht, würden wir uns längst die Köpfe einschlagen.
Girard hält eine schöne Pointe für jene bereit, die sich den totalen Egalitarismus auf die Fahnen geschrieben haben: Die egalitäre Gesellschaft beseitigt die Konflikte nicht, sondern intensiviert sie sogar.
Daran kann vernünftigerweise kein Zweifel bestehen. Zugleich ist es äusserst schwierig, gegen mehr Gleichheit zu argumentieren – sollte dies ein Politiker je offen tun, wäre das politischer Selbstmord. Es ist dies eine grosse Illusion der späten Moderne: Mehr Gleichheit macht uns friedlicher. Girard hält den Finger in die Wunde, er hat in allen Details beschrieben und analysiert, dass durch das Sich-Vergleichen eine gesellschaftliche Dynamik in Gang gesetzt wird, die genau das Gegenteil bewirkt. Ein zweiter Punkt kommt hinzu: die Sündenbock-Komponente. Wer sich ständig zurückgesetzt und schlecht behandelt fühlt – und das sind ja mittlerweile eigentlich fast alle –, macht stets eine Drittinstanz für sein Unglück verantwortlich – den Vater, die Politik, das System. René Girard ist insofern wirklich der Philosoph auf der Höhe der Zeit.
Kommen wir auf die Identitätspolitik zu sprechen. Man könnte sie vor diesem Hintergrund als eine Maschinerie bezeichnen, die es darauf abgesehen hat, die gesellschaftlichen Unterschiede perfekt zu bewirtschaften.
Identitätspolitik hat Wurzeln im Stammesdenken, ist aber zugleich ein Produkt unserer späten Moderne: Es werden ständig kollektive Unterschiede wie Hautfarbe, Gender, Ethnie und sexuelle Orientierung geltend gemacht, nur um darauf hinzuweisen, dass Gleichbehandlung unter Menschen noch nicht erreicht ist. Dadurch werden die Unterschiede unter den Menschen laufend vertieft. Wir kehren zurück zu einer Art Stammes- oder Ständegesellschaft in einer de facto egalitären Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt nebeneinander leben. Das ist wirklich total verrückt und verwirrend.
Die USA sind Vorreiter in dieser Angelegenheit. Beobachten Sie die Entwicklung mit Sorge – oder mit grosser Gelassenheit?
Mit Gelassenheit. Der Fokus auf diese Art der kollektiven Identität beruht auf einem Grundwiderspruch: Die Gruppenidentität ist einerseits das, was mich einzigartig machen soll und also von allen anderen unterscheidet; zugleich ist sie das, was mich mit anderen verbindet, die über dieselbe Ethnie oder Hautfarbe verfügen. Sie ist mithin zugleich A und Nicht-A. Irgendwann geht den Leuten auf, dass beides nicht geht. Die kognitive Dissonanz lässt sich nicht ewig aufrechterhalten. Aber ich halte die ganze Frage letztlich nicht für matchentscheidend. Ich frage mich eher, wovon der ganze Hype um Identitätspolitik ablenken will. Und ich habe Ihnen die Antwort bereits gegeben: von ökonomischer Stagnation. Ich wundere mich immer, dass die Linken das Thema nicht längst für sich entdeckt haben.
Sie sind so freundlich und geben Ihren politischen Gegnern Tipps?
Klar, wenn es hilft. Nein, im Ernst: Die Rechte beginnt sich der Problematik anzunehmen, nicht nur in den USA. Und dies zu Recht. Die Stagnation hat in den 1970er Jahren begonnen. Die Linke vollführte damals einen radikalen Wechsel, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein: Ökonomie wurde durch Kultur verdrängt, es ging nicht mehr um soziale, sondern um kulturelle Unterschiede. Die Linken haben seither jeden ökonomischen Sachverstand eingebüsst, sie sind auf die Stufe von Kindern regrediert. Der langsame Niedergang der Sozialdemokraten begann damals, die Zeit der Grünen brach an, also die Zeit der linken Paternalisten, die anderen sagen, wie sie gute Menschen sein können und gut zu leben haben. Wenn wir verstehen wollen, was heute geschieht, müssen wir zurück in die 1970er Jahre, davon bin ich zutiefst überzeugt.
Peter Thiel – ein echter Contrarian
rs. · Über den Hügeln ist Ruh, als ich die Auffahrt zu Peter Thiels Villa zwischen Beverly Hills und Hollywood hoch spaziere. Ein sanfter Wind weht, der Himmel strahlt hellblau, die Sonne brennt. Ein Assistent begrüsst mich vor dem Eingang des modernen Baus auf Deutsch: «Ich bin Alex.» Er führt mich in ein schickes Wohnzimmer, eine Glasfront gibt den Blick frei auf eine pulsierende Stadt: Los Angeles. «Warte kurz, Peter kommt gleich.»
Peter Thiel ist vor ein paar Jahren hierhin gezogen, im Silicon Valley hat er es nicht mehr länger ausgehalten: zu viel Konformismus. Aber ab und an ist er weiterhin in Palo Alto anzutreffen, zum Beispiel, wenn er in Stanford ein Seminar gibt, und das heisst: sich zusammen mit ausgesuchten Studenten auf ein intellektuelles Abenteuer begibt.
2012 schon hat Thiel einen Kurs über Startups abgehalten, aus dem der Bestseller «Zero to One. Wie Innovation unsere Gesellschaft rettet» hervorgegangen ist (Campus 2014). Diesmal lautet der Titel der Veranstaltung «Souveränität und die Grenzen von Globalisierung und Technologie». Thiel gibt das Seminar zusammen mit Russell Berman, Professor für Germanistik und Spezialist für Theodor W. Adorno und Thomas Mann.
An der letzten Sitzung des Seminars Mitte März werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Denken von René Girard, Leo Strauss und Carl Schmitt en détail herausgearbeitet. Drei Stunden Dialog und Disput am Stück, von nachlassender Konzentration, Müdigkeit ist weder bei Thiel noch bei den Studenten etwas zu spüren. Die Veranstaltung beruht auf einem Versprechen, das alle Teilnehmer verbindet: Sie wollen nach dem Seminar klüger sein als zuvor.
Peter Thiel, der zusammen mit Freunden den Online-Bezahldienst Paypal gründete, aufbaute und 2002 an Ebay verkaufte, hat zunächst tatsächlich Philosophie des 20. Jahrhunderts in Stanford studiert (und später Jus). Er verkörpert exemplarisch einen neuen Typus des Intellektuellen: den machenden Denker und denkenden Macher, der die Welt verändert. Der Freundeskreis um Thiel ist unter dem ironischen Begriff der «Paypal-Mafia» in die Geschichtsbücher eingegangen – neben ihm waren das unter anderen Reid Hoffman (LinkedIn), Elon Musk (Tesla und SpaceX) und Chad Hurley (Youtube). Seit dem Verkauf von Paypal ist der 1967 in Frankfurt am Main geborene Deutsch-Amerikaner engagierter Investor, Philanthrop und streitbarer öffentlicher Intellektueller. 2016 unterstützte er den Wahlkampf Donald Trumps und wurde nach dessen Wahl zum Berater des Präsidenten in Technologiefragen.
Thiel, der perfekt Deutsch spricht, unterscheidet prinzipiell zwischen zwei Motoren des Fortschritts: Intension und Extension, technischer Innovation und globaler Diffusion. Wer Neues erfindet, macht den entscheidenden Schritt von 0 auf 1, während die Globalisierung die Neuerung in einem zweiten Schritt vielen Menschen zugänglich macht. Nach Thiels Einschätzung leben wir seit Jahrzehnten in einer Welt globaler technischer Stagnation, allerdings ohne dies wirklich zu begreifen. Was wir brauchen, sagt Thiel, sei deshalb echte Innovation. Und die findet seiner Ansicht nach nur statt, wenn ein Unternehmer ein Monopol in einer Nische zu schaffen vermag – wer hingegen das Hohelied der Konkurrenz anstimmt, habe nichts von Unternehmertum verstanden. Unternehmer ist, wer die Preismacht hat (und seine Kunden zugleich glücklich macht).
Durch seine Biografie zieht sich ein roter Faden: Thiel liebt es, anzuecken und gegen den Strom zu schwimmen. Er ist das, was man im Englischen einen Contrarian nennt.
Ich bewundere noch die Aussicht von den Hügeln über Los Angeles auf die Metropole, als er plötzlich neben mir steht, in Jeans und Poloshirt. Er bewegt sich auf leisen Sohlen. Das erste Abtasten erledigen wir auf Deutsch, es wird ein Paläo-Menu serviert: frischer Lachs und Gemüse, wunderbar zubereitet, zuletzt ein paar Nuss-Kekse. Schon geht’s los – und es entspinnt sich ein langes Gespräch. Thiels Denken ist rasch und beweglich. Worthülsen sind ihm verpönt. Oftmals schweigt er lange, bevor er antwortet. Wenn er innehält, wendet er den Blick in die Weite und schaut in Richtung der Stadt, die ihm zu Füssen liegt. Dann formuliert er seine Sätze in breitem Amerikanisch und voller Energie. Entweder Pause oder Pace, 0 oder 1 – nur nichts dazwischen!
Anmerkung der Redaktion : Contrarian = Querdenker
Quelle: NZZ.ch
Bilder: Wikimedia – Bearbeitet
Bilder :Attribution – Bearbeitet
Bilder: Unsplash – Greg Bulla
Pixabay – Geralt
piqsels.com-id-fcsqk
Unsplash – 丁亦然
Unsplash – Jan Canty
Unsplash – Darius Soodmand
piqsels.com – id-jurla
Querdenken-761 Wir benötigen finanzielle Hilfe
Wir haben bis jetzt den größten Teil der Ausgaben durch unser Team finanziert aber jetzt benötigen wir Hilfe.
Wir müssen nun Mitarbeiter einstellen, da wir die Arbeit nicht mehr allein bewältigen können
Auch haben wir „Medial“ aufgerüstet und unsere erste Zeitung herausgegeben – unter www.qfm.network ist das erste „Querdenken Radio“ in Betrieb genommen worden.
Jetzt mit neuer Radio-Qfm-APP für Apple und Android
Die Testphase unseres neuen Radiosenders ist abgeschlossen und Sie können sich – von 7:00 – 0:00 Uhr jede Stunde – auf spannende aktuelle Moderationen und 24 Stunden durchgehend die beste und aktuellste Musik freuen.
Wir möchten so viel mehr Menschen erreichen – aber diese Projekte haben unsere ganze Kraft aber auch unsere Ressourcen verbraucht
Wir werden in den nächsten Tagen noch einige Spendenaufrufe starten und hoffen, dass Sie uns unterstützen.
Mitdenken Freiburg
Auf das Konto:
DE61 1001 1001 2620 3569 10
BIC: NTSBDEB1XXX
Betreff:
„Mitdenken Spende Kto. R. Freund“
Patreon – https://www.patreon.com/Querdenken761
Paypal – ron@nichtohneuns-freiburg.de




